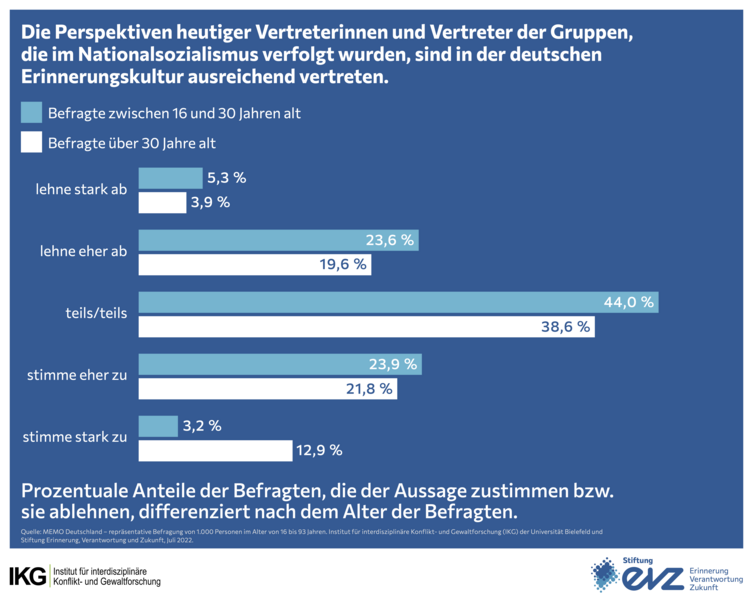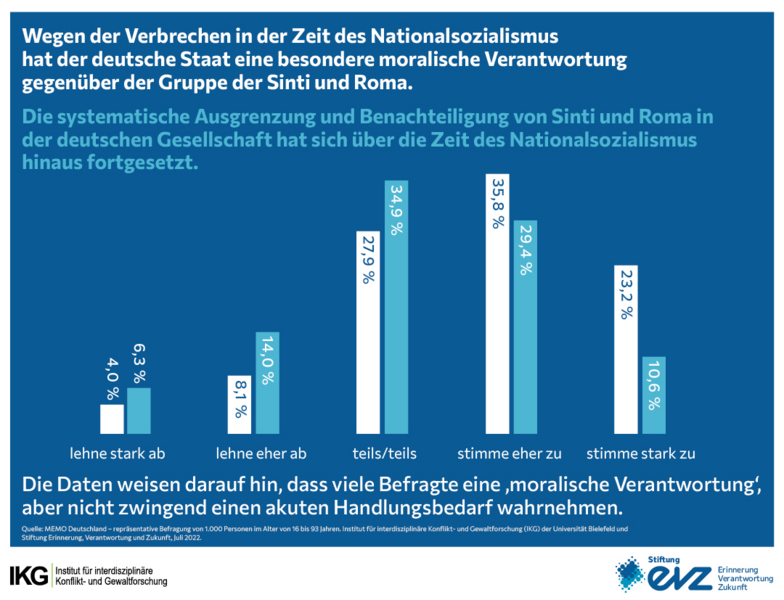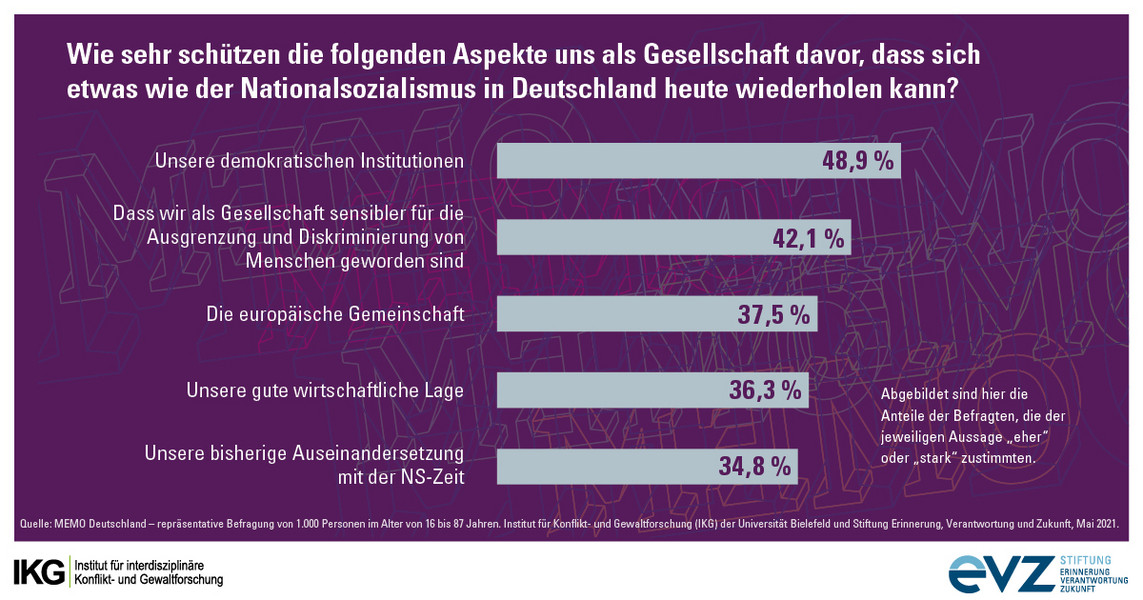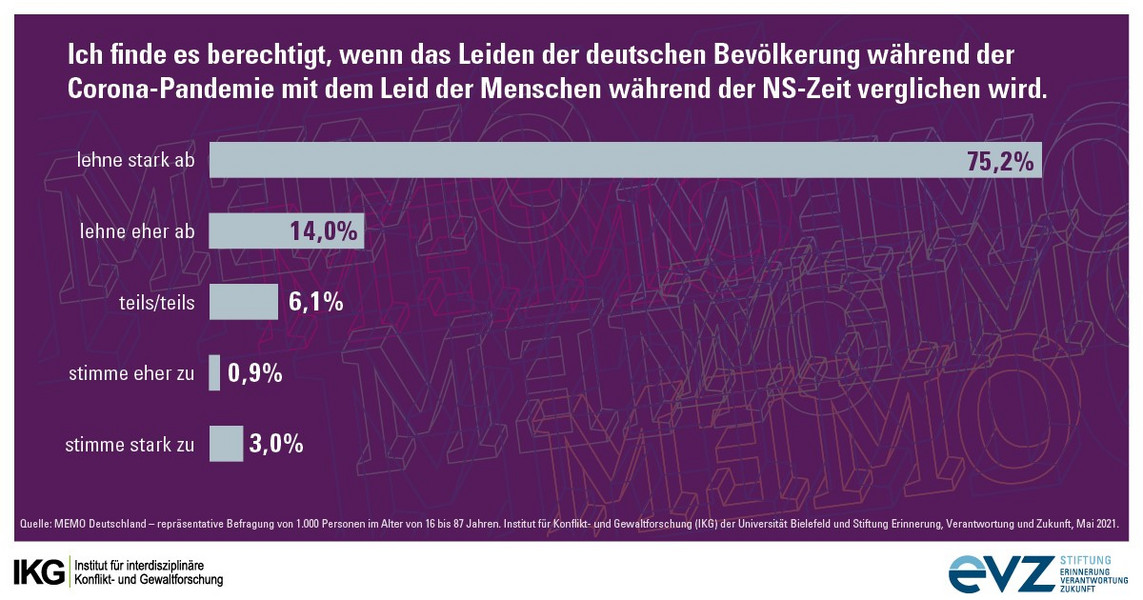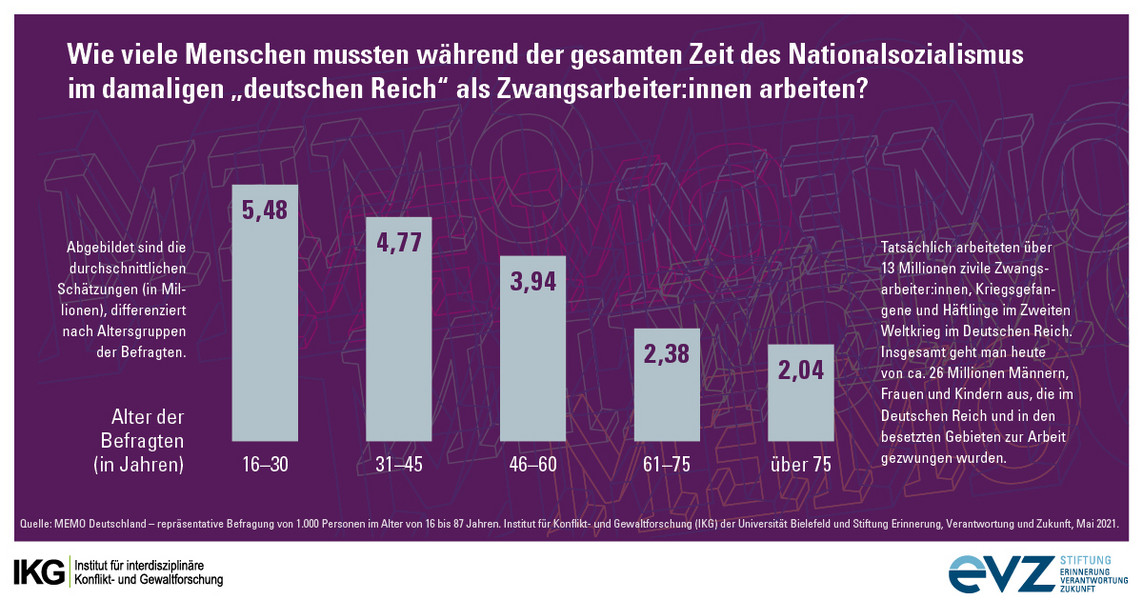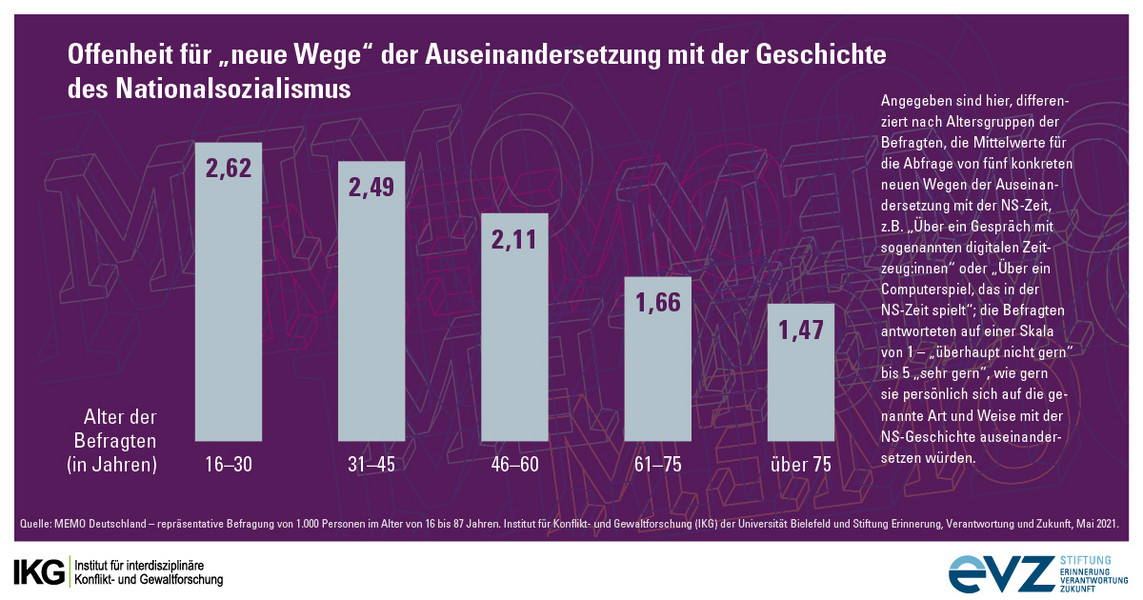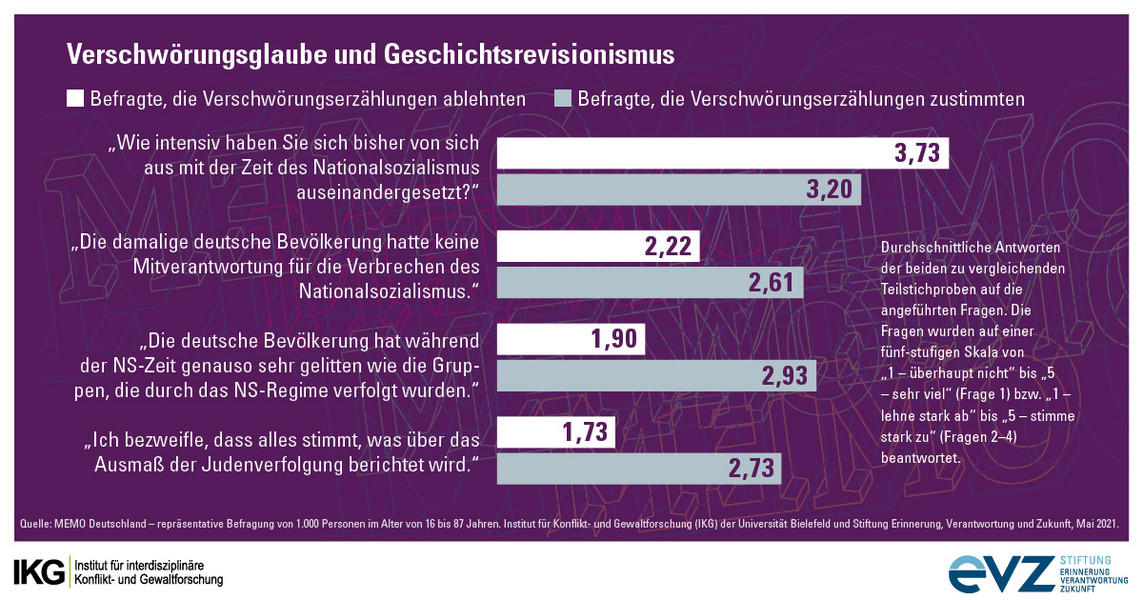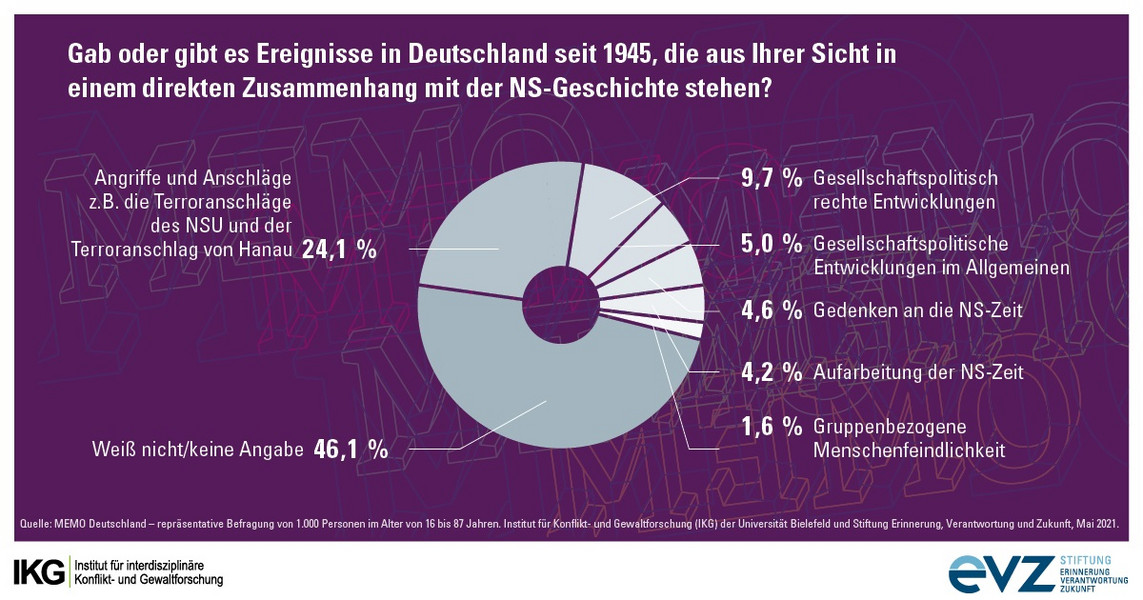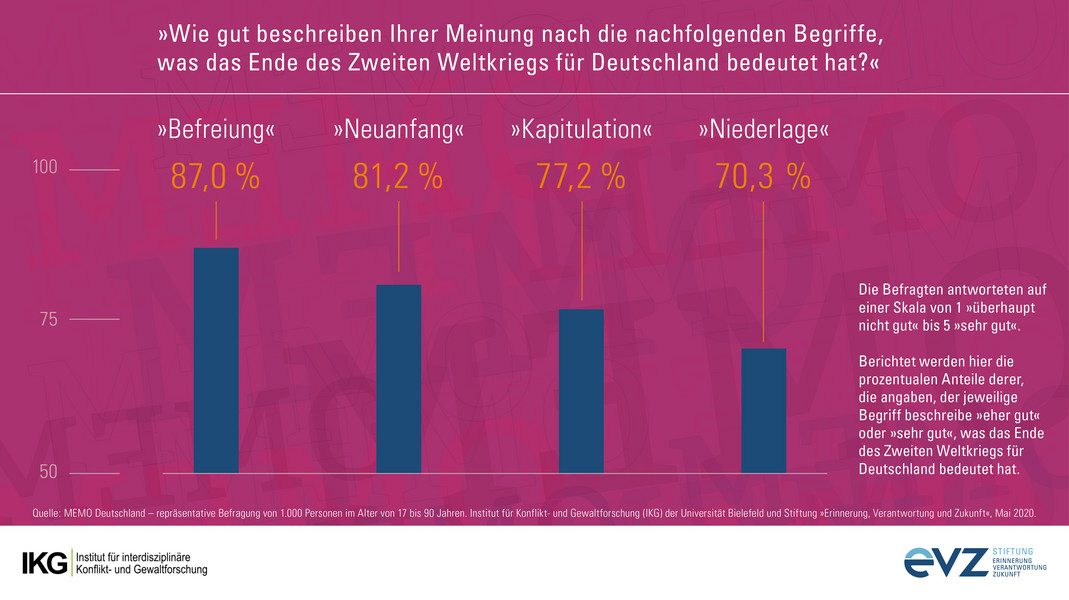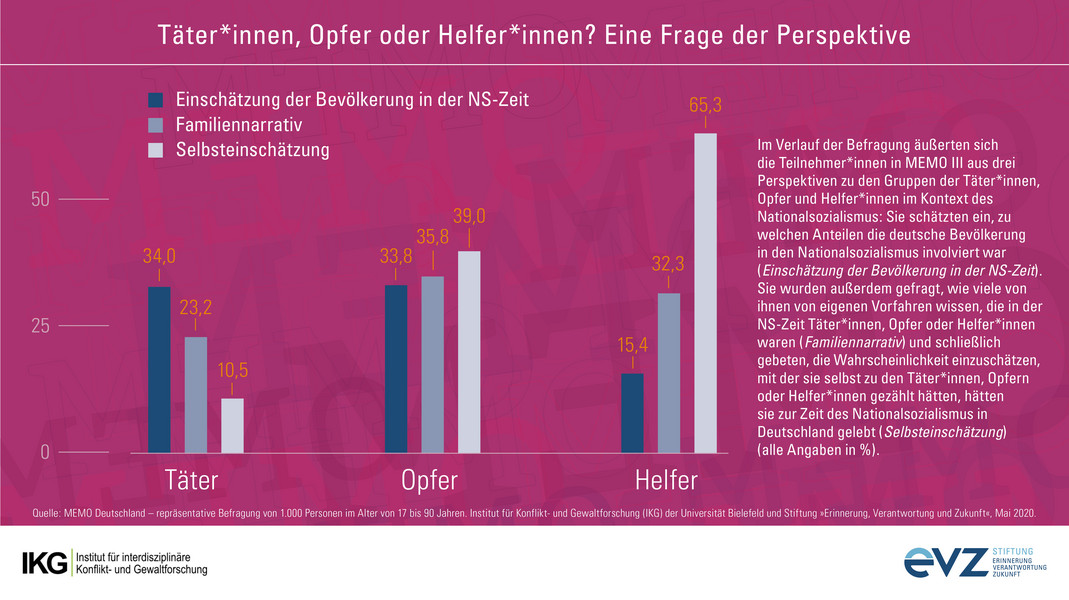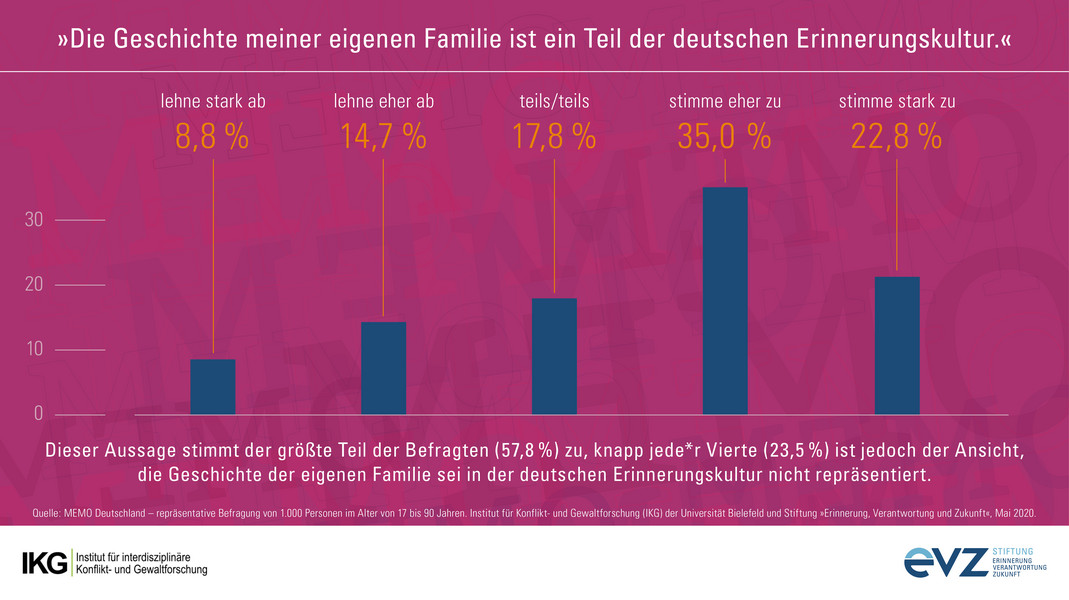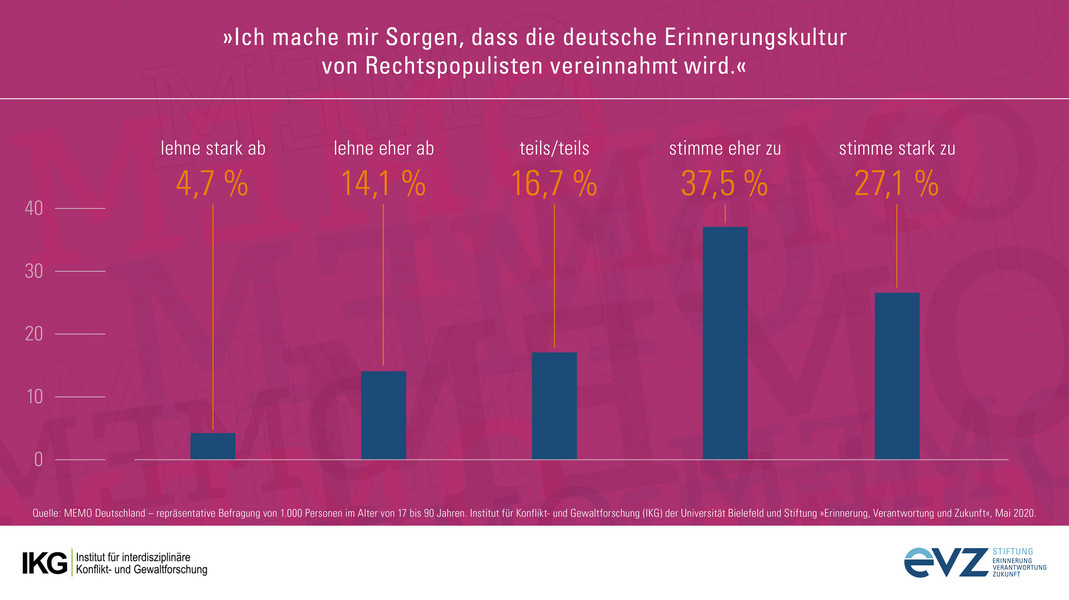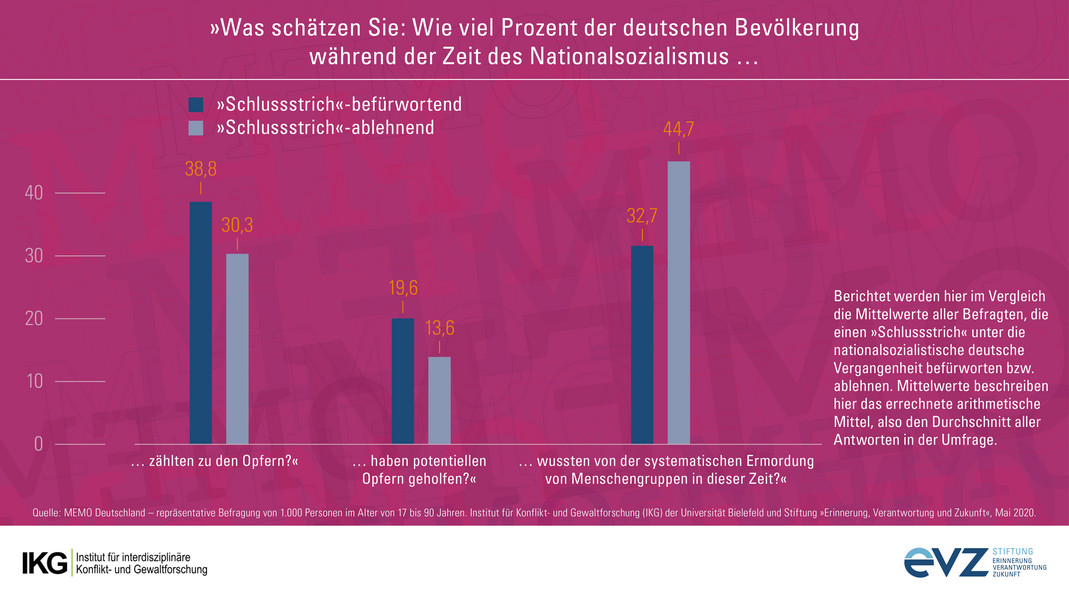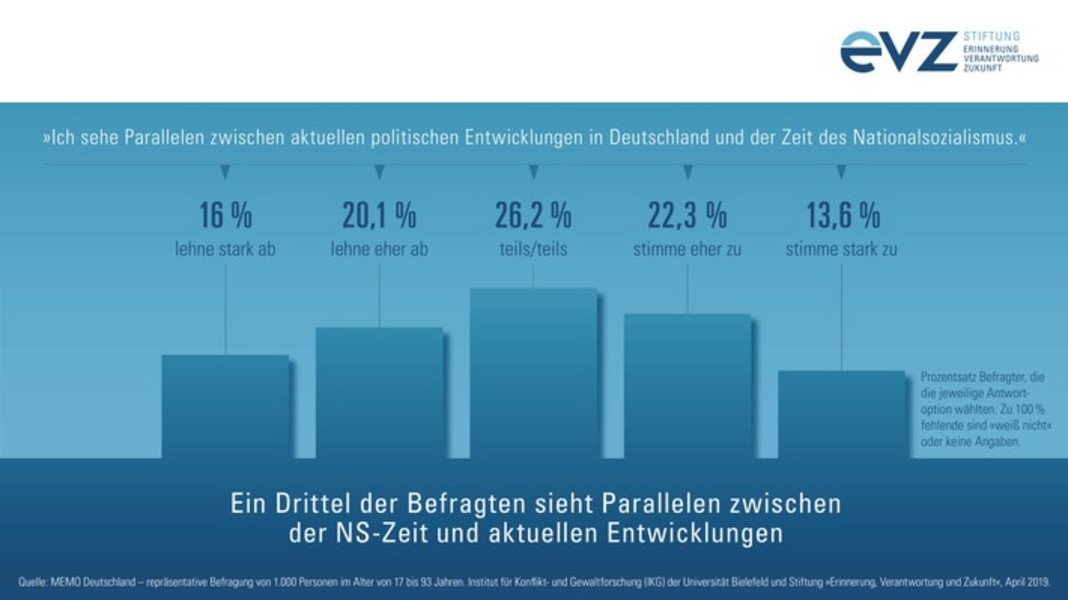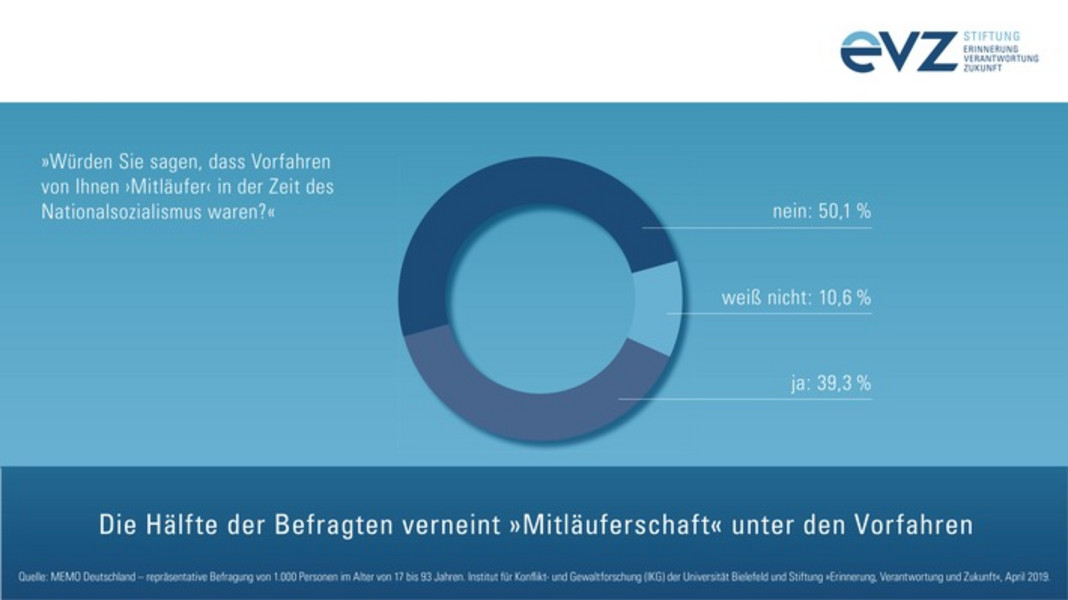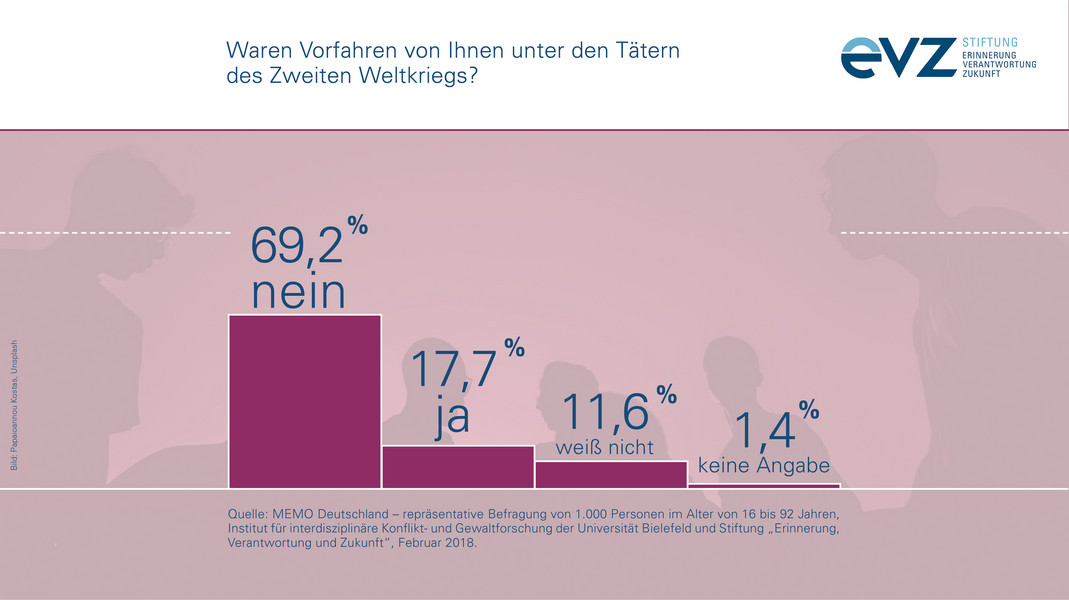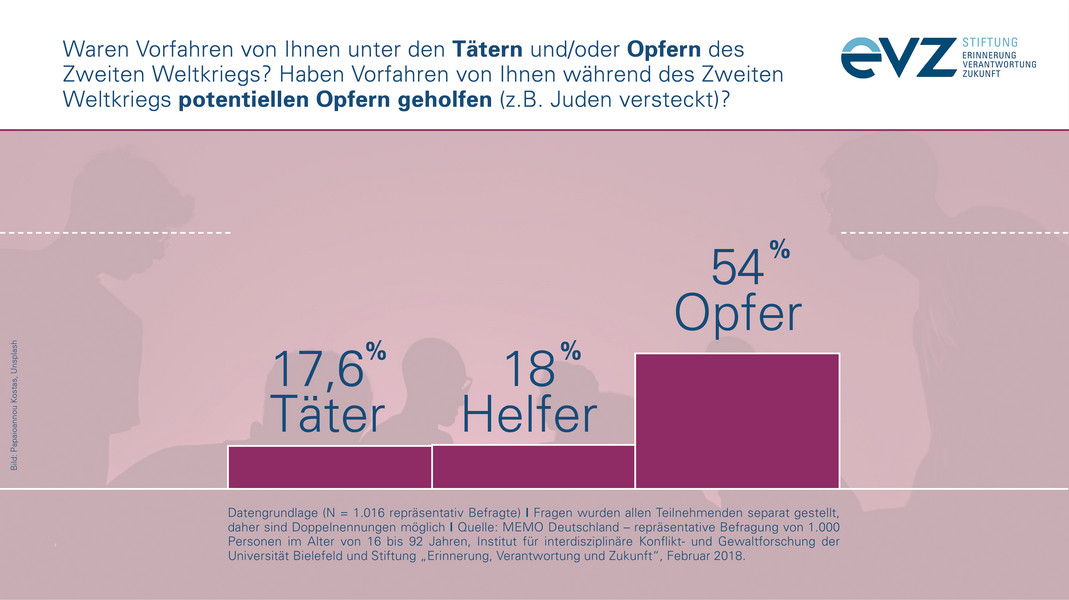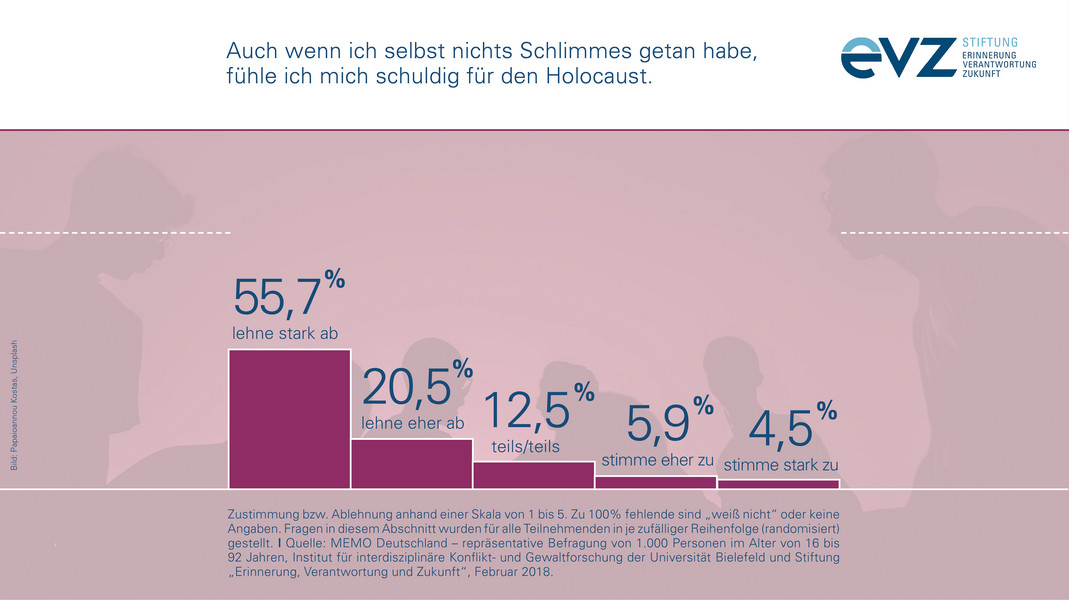STUDIE PROJEKTPARTNER:INNEN
MEMO Deutschland – Multidimensionaler Erinnerungsmonitor - STUDIE V
Die Erinnerung der Deutschen an den Zweiten Weltkrieg ist von Ereignissen und Orten in Westeuropa geprägt. Dies ist ein Ergebnis von MEMO - dem Multidimensionalen Erinnerungsmonitor. Die fünfte Studie zur Erinnerungskultur in Deutschland zeigt, dass 58,5 Prozent der 1.000 repräsentativ Befragten noch nie bewusst einen Ort der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und an seine Opfer außerhalb Deutschlands besucht haben. Diejenigen, die an Erinnerungsorten außerhalb der Landesgrenzen waren, beziehen sich am häufigsten auf Frankreich und dort auf die Kriegsschauplätze in der Normandie.
Michael Papendick, Jonas Rees, Maren Scholz & Andreas Zick Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) Universität Bielefeld Berlin, Bielefeld 2022 33 Seiten Sprachen: Deutsch, Englisch